Nach Kündigung: „krankfeiern“ bis zum Austritt?
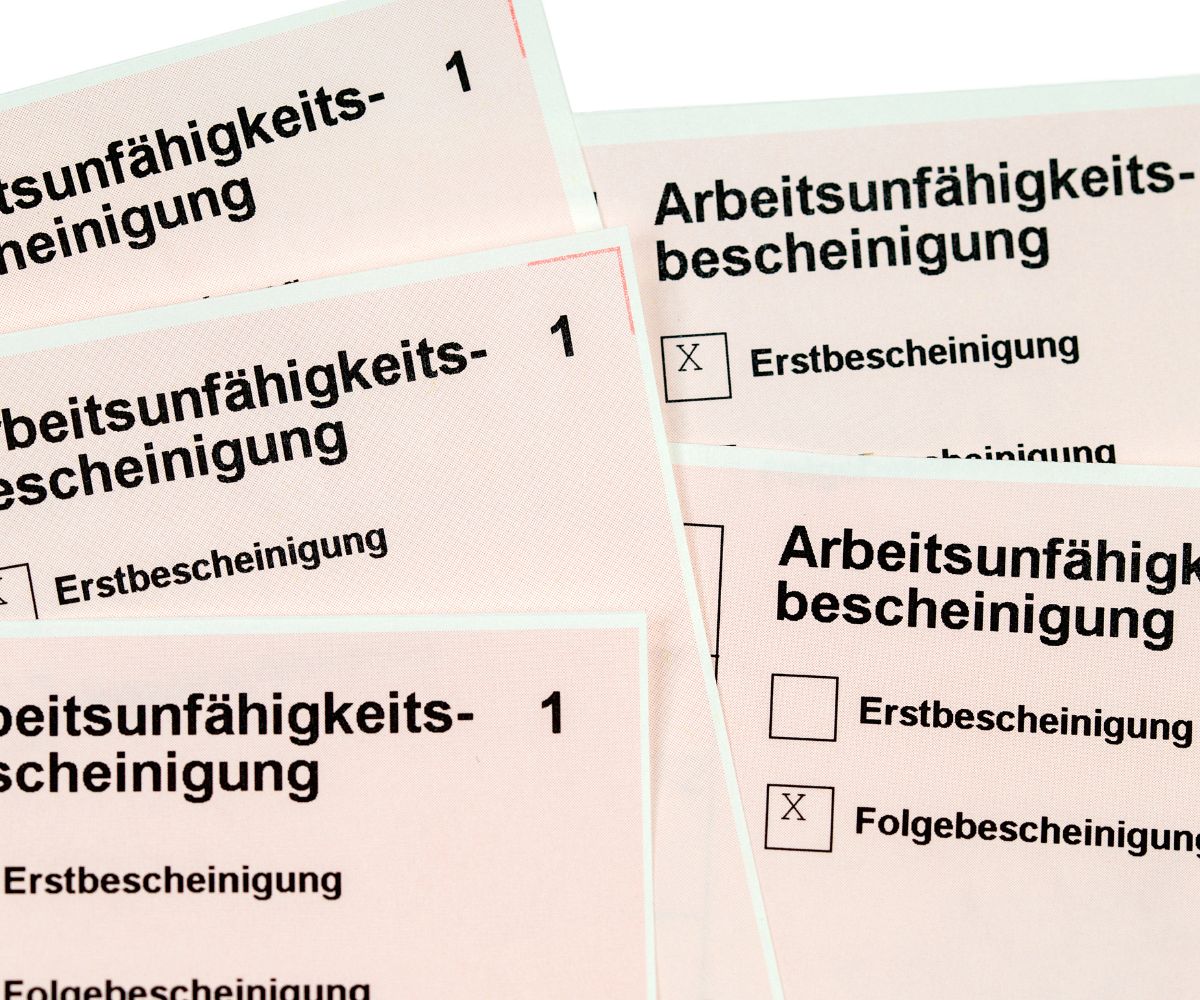
Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) schützt Arbeitnehmer, die arbeitsunfähig erkrankt sind. Dieser Schutz besteht in der Regel bis zu sechs Wochen. Der Arbeitgeber zahlt in diesem Zeitraum den vollen Lohn. Erst danach übernimmt die Krankenkasse und zahlt ein (meist geringeres) Krankengeld. Dies gilt grundsätzlich auch bei bereits erfolgter Kündigung. Als Beweis für die Krankheit reicht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (im Folgenden: AU) aus, da einem ärztlichen Attest ein hoher Beweiswert zukommt. Eines weiteren Beweises bedarf es daher nicht.
Der einer ärztlichen (Folge-)AU innewohnende Anscheinsbeweis für das tatsächliche Vorliegen einer Erkrankung kann jedoch unter Umständen erschüttert sein, wenn der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach Zugang der Kündigung eine oder mehrere Folgebescheinigungen vorlegt, die passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfassen, und er unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses – dann wieder arbeitsfähig – eine neue Beschäftigung aufnimmt. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer bereits vor Zugang der Kündigung durch den Arbeitgeber arbeitsunfähig war und die AU nach Zugang einer arbeitgeberseitigen Kündigung passgenau bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verlängert wird.
Im zugrundeliegenden Fall vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte der Arbeitgeber wegen gehegten Misstrauens am Beweiswert der AUB aufgrund der Deckungsgleichheit der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit und der Kündigungsfrist das Entgelt zurückgehalten. Zudem hatte der Ex-Arbeitgeber Kenntnis erhalten, dass der Arbeitnehmer am Tag nach dem Austrittstermin eine neue Arbeitsstelle antrat.
Der konkrete Fall
Die Parteien streiten über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Der Kläger war seit mehr als einem Jahr bei dem beklagten Arbeitgeber beschäftigt. Der Kläger legte dem Arbeitgeber am 2. Mai eine AU für die Zeit vom 2. bis zum 6. Mai vor. Mit Schreiben vom 2. Mai, dem Kläger am 3. Mai zugestellt, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristgemäß zum 31. Mai. Mit mehreren lückenlosen Folgebescheinigungen wurde die Arbeitsunfähigkeit des klagenden Arbeitnehmers insgesamt bis zum 31. Mai bescheinigt. Ab dem 1. Juni war der Kläger wieder arbeitsfähig und ging einer neuen Beschäftigung nach.
Die Beklagte verweigerte in der Folgezeit die Entgeltfortzahlung ab dem 2. Mai und sah den Beweiswert sämtlicher AU-Bescheinigungen als erschüttert an. Die Krankmeldung war am gleichen Tag wie die Kündigung erfolgt und hatte dann auch noch genau bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses gedauert. Das waren für die Arbeitgeberin genug Hinweise, um anzunehmen, die Krankmeldung sei nur vorgetäuscht gewesen. Dem widersprach der Arbeitnehmer und argumentierte, die Arbeitsunfähigkeit habe bereits vor dem Zugang der Kündigung bestanden.
Der Kläger forderte die Beklagte erfolglos zur Zahlung seines Arbeitslohns für den Monat Mai auf und verfolgte seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall weiter im Wege der Klage. Die Beklagte beantragt Klageabweisung und argumentiert, dass die AU aufgrund der Passgenauigkeit auf den Zeitraum der Kündigungsfrist und der anschließenden Arbeitsfähigkeit des Klägers ihren Beweiswert verloren habe.
Vorinstanzen gaben Kläger Recht
Die Vorinstanzen haben der auf Entgeltfortzahlung gerichteten Klage für den gesamten Zeitraum stattgegeben.
Sie sahen keinen Beweis von tatsächlichen Umständen, die Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers begründeten. Der Arbeitgeber hätte den Beweiswert der Krankmeldung erschüttern müssen, konnte dies jedoch nicht.
Meldet sich zunächst der Arbeitnehmer krank und erhält erst im Anschluss eine arbeitgeberseitige Kündigung, konnte nicht angenommen werden, dass die Kündigung die Motivation für den Kläger war, einen Arzt aufzusuchen. Es fehlt zudem an dem für die Erschütterung des Beweiswertes der AU notwendigen Kausalzusammenhang. Allein die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses arbeitsunfähig krankgeschrieben ist, am unmittelbar darauffolgenden Tag gesundet und bei einem anderen Arbeitgeber zu arbeiten beginnt, erschüttert in der Regel ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht den Beweiswert einer AU, so das Landesarbeitsgericht Niedersachsen in der 2. Instanz. Das gilt insbesondere dann, wenn lückenlos der gesamte Zeitraum der Kündigungsfrist – auch durch mehrere AU – abgedeckt wird.
BAG differenziert
Das BAG gab in der Revision dem beklagten Arbeitgeber nur teilweise – bezogen auf den Zeitraum vom 7. bis zum 31. Mai – Recht.
Grundsätzlich trägt der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen einer arbeitsunfähigkeitsbedingten Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers. Dabei kommt einer ordnungsgemäß ausgestellten AU aufgrund der Vorgaben im EFZG ein hoher Beweiswert für das Vorliegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit zu.
Eine Erschütterung des Beweiswerts der AU seitens des Arbeitgebers ist aber dadurch möglich, dass der Arbeitgeber tatsächliche Umstände darlegt und im Bestreitensfall beweist, die ernsthafte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers infolge Erkrankung begründen. An den dahingehenden Vortrag des Arbeitgebers sind keine hohen Anforderungen zu stellen, da er nur über eingeschränkte Erkenntnismöglichkeiten verfügt. Zweifel an der AU können bereits dadurch entstehen, dass sich der Arbeitnehmer im Anschluss an eine vom Arbeitgeber erhaltene Kündigung krankmeldet. Nicht maßgeblich für den Beweiswert der AU ist indes, von wem die Kündigung ausgeht und ob eine oder mehrere AU eingereicht werden. Auch ein passgenaues Attest bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses erschüttert den Beweiswert der AU. Gleiches gilt bei einer attestierten Arbeitsunfähigkeit, wenn der Arbeitnehmer unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Stelle tatsächlich gesund antritt. Es müsse stets eine Würdigung der Gesamtumstände im Einzelfall vorgenommen werden.
Hiernach ist im vorliegenden Fall der Beweiswert der ersten AU-Bescheinigung vom 2. Mai für die Zeit bis zum 6. Mai nicht erschüttert; ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht. Die Kündigung war dem Kläger erst einen Tag nach Vorlage der AU-Bescheinigung zugegangen. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Kürze rechnen musste (z.B. bei einer Anhörung durch den Betriebsrat) waren nicht gegeben. Der Kläger hatte daher bei der Vorlage der AU nichts von der Kündigung gewusst, sodass keine zeitliche Koinzidenz zwischen der Kündigung und der AU gegeben war.
Die Gesamtschau der Umstände begründet allerdings ernsthafte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit des Klägers ab dem 7. Mai. Insoweit sah das BAG eine zeitliche Koinzidenz als gegeben und den Beweiswert der Folge-AU-Bescheinigungen vor dem Hintergrund der mittlerweile erfolgten Kündigung als erschüttert. Diese Koinzidenz wurde in der Gesamtschau durch die passgenaue Verlängerung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sowie den Umstand bewirkt, dass die letzte Folgebescheinigung – anders als die Vorbescheinigungen – nicht an einem Freitag, sondern an einem Dienstag ablief und am folgenden Mittwoch, dem 1. Juni eine neue Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber durch den Kläger aufgenommen wurde. Somit war es wieder Sache des Arbeitnehmers, für die Zeit vom 7. bis zum 31. Mai seine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung für den Entgeltfortzahlungsanspruch darzulegen bzw. zu beweisen.
Was folgt aus dem BAG-Urteil?
Im Ergebnis hat das BAG seine bisherige Rechtsprechung im Hinblick auf die Beweislast von AU weiterentwickelt, insbesondere bezogen auf eine Kündigung – egal von welcher Seite sie ausgesprochen wird.
Diese Entwicklung ist zu begrüßen, da ein Arbeitgeber im Falle einer Erkrankung i. d. R. keine Informationen zur Art und Ausmaß der Erkrankung des Mitarbeiters hat. Deshalb sind keine allzu hohen Anforderungen an dessen Einwendungen zur Erschütterung des Beweiswerts von AU zu stellen. Vielmehr kann nach Ausspruch einer Kündigung eine über die komplette Kündigungsfrist andauernde Arbeitsunfähigkeit mit anschließender Genesung pünktlich zum Antritt einer neuen Beschäftigung ausreichen, um den Beweiswert der Bescheinigung zu erschüttern. Für den Arbeitnehmer bedeutet das BAG-Urteil indes nicht automatisch den Ausfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Folge ist lediglich, dass die Beweislast dann wieder beim Arbeitnehmer liegt, der im Zweifelsfall darlegen muss, dass er tatsächlich krank war. Möglich ist dies beispielsweise mit einer Erläuterung der Krankheitsumstände durch ärztliche Befunde und zudem könnte der Arzt, der die AUB ausgestellt hat, als Zeuge auftreten.
Andererseits sollten sich Arbeitgeber durch diese BAG-Entscheidung nicht herausgefordert fühlen, auch in weiteren Fallgestaltungen im Kontext von Entgeltfortzahlung im Zusammenhang der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses die Zahlung stets und unbedacht zu verweigern. Ebenso wie das BAG selbst anregt, sollte vielmehr stets überprüft werden, ob die Gesamtschau der Umstände eine solche Entscheidung überhaupt trägt, zumal der Arbeitnehmer für das tatsächliche Vorliegen der Erkrankung stets noch den Vollbeweis führen könnte, etwa durch Vernehmung der ihn behandelnden Ärzte.


