Testierfähigkeit bei Parkinsonerkrankung
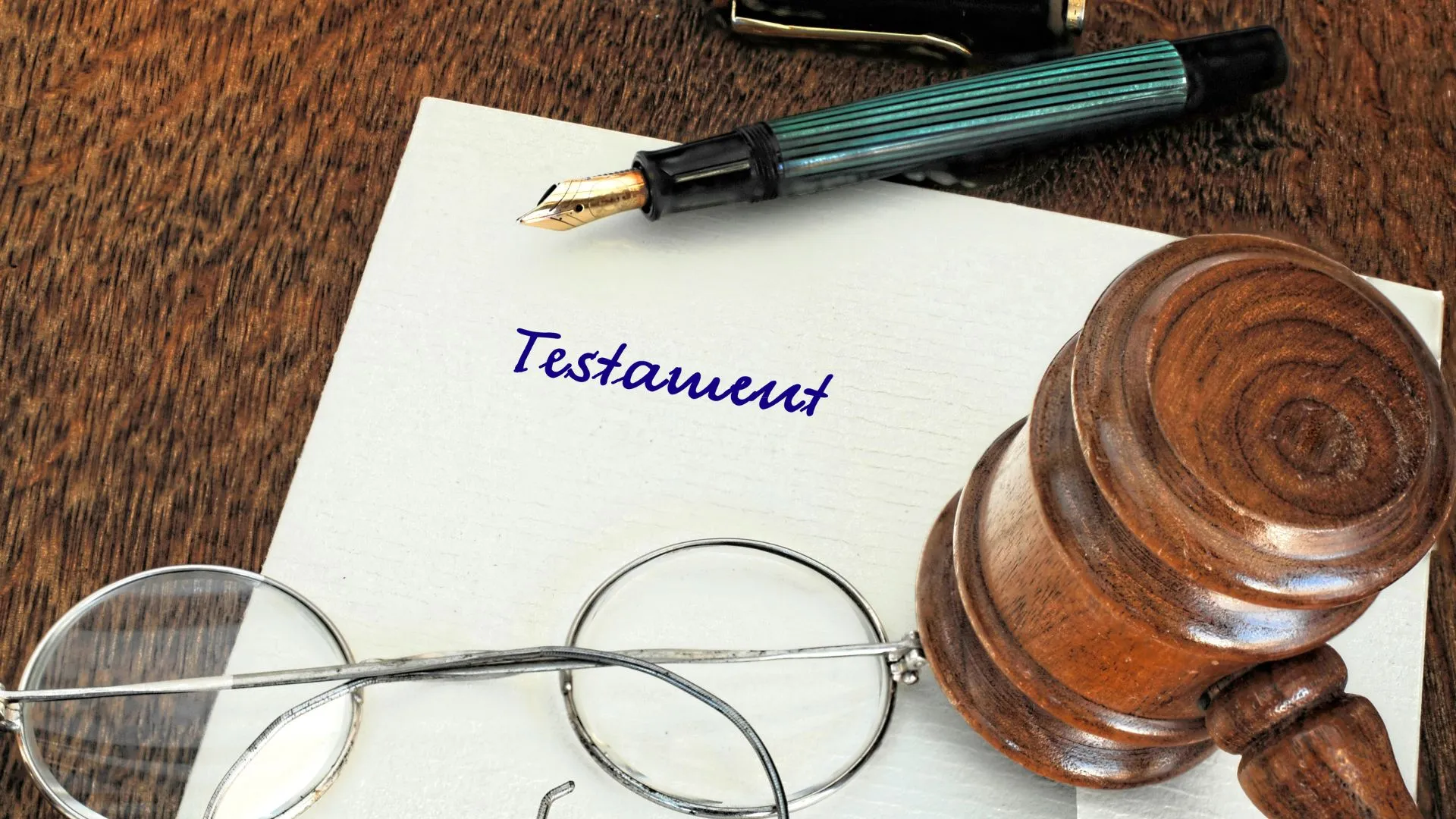
Parkinson ist eine Erkrankung, die zu verschiedenen gesundheitlichen, insbesondere motorischen Einschränkungen führen kann. Aber hat diese Erkrankung auch zur Folge, dass man kein gültiges Testament mehr schreiben kann? Das Kammergericht (KG) Berlin hatte sich kürzlich mit dieser Frage zu befassen.
Erbrechtlicher Streit um handschriftliches Testament: Schlusserbin fechtet Verfügung wegen möglicher Geschäftsunfähigkeit an
In dem vom KG Berlin entschiedenen Fall verfasste ein kinderloses Ehepaar 1998 ein gemeinschaftliches Testament. Sie setzten sich gegenseitig als Alleinerben und eine Nichte der Ehefrau als Schlusserbin ein.
Seit 2015 leidet der Ehemann an Parkinson. Nachdem die Ehefrau verstorben war, erstellte der Ehemann im Jahr 2020 ein eigenhändiges Testament – handschriftlich verfasst auf der Rückseite eines Ausdrucks des Speiseplans eines Cafés – in dem er seinen Nachbarn als Alleinerben einsetzt. Einige Monate später ergänzte er dazu noch, dass der Sohn des Nachbarn der Ersatzerbe sein soll.
Nach dem Tod des Ehemannes im Jahr 2021, beantragte der Nachbar die Erteilung eines Erbscheins, um das Erbe anzutreten.
Die im ersten gemeinschaftlichen Testament als Schlusserbin eingesetzte Nichte hält sich für die einzig rechtmäßige Erbin. Sie erklärte die Anfechtung des letzten Testaments und stellte neben der Echtheit des Testaments auch die Geschäftsfähigkeit des Erblassers bei der Testamentserstellung in Frage.
Parkinson-Erkrankung und rechtliche Situation
Der eben geschilderte Fall betrifft zwei rechtliche Problembereiche, für die folgendes Grundlagen-Wissen notwendig ist:
Wer darf testieren?
Laut § 2229 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann jemand kein Testament errichten, wenn er aufgrund einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit, Geistesschwäche oder Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung seiner Willenserklärung zu verstehen und danach zu handeln.
Die Parkinson-Erkrankung ist eine neurodegenerative Krankheit, die in erster Linie motorische Symptome wie Gangunsicherheit, Stürze, Zittern und Sprechstörungen verursacht. Allerdings kann sie sich auch auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken.
Testamentserrichtung – welche formellen Anforderungen gelten?
Das Gesetz schreibt zur Errichtung eines eigenhändigen Testaments nicht die Verwendung eines bestimmten Schriftträgers vor. Für die Ermittlung des Testierwillens bei Verwendung eines solchen Schriftträgers ist nicht die Wahl des Schreibmaterials maßgeblich, sondern die Frage, ob sich das Papier zur Fixierung der Schriftzüge eignet und nicht etwa aus der Wahl des Schreibmaterials erkennbar wird, dass der Testierende seine Verfügung ernstlich gar nicht hat treffen wollen.
Urteil des Kammergerichts
Das KG stellte fest, dass das letzte Testament formwirksam war, obwohl es auf der Rückseite eines Speiseplans eines Cafés verfasst wurde. Das KG argumentierte, dass die Wahl des Schriftträgers nicht entscheidend ist, solange die Urkunde alle notwendigen Informationen enthält und den Willen des Erblassers ausreichend wiedergibt. Daran bestand aber hier kein durchgreifender Zweifel, weil das Dokument mit „Mein Testament“ überschrieben, mit dem vollen Namen und Geburtsdatum des Erblassers sowie des Begünstigten in einem für Testamente üblichen Wortlaut geschrieben, mit Ort und Datum versehen und von dem Erblasser unterschrieben war.
Ferner stellte das KG fest, dass der Erblasser trotz seiner Parkinson-Erkrankung testierfähig war und ein gültiges Testament schreiben konnte. Um als testierunfähig angesehen zu werden, muss die Person die Fähigkeit zur Einsicht und Handlung verloren haben. Bei der Parkinson-Erkrankung stehen motorische Störungen im Vordergrund und kognitive Einschränkungen sind eher selten. Wenn keine konkreten Symptome die Fähigkeit zur freien Willensbestimmung beeinträchtigen, gilt die gesetzliche Vermutung, dass die Person in der Lage ist, ein Testament zu schreiben.
Mit einer Parkinson-Erkrankung geht demnach nicht automatisch eine Einschränkung der freien Willensbestimmung einher, die Testierunfähigkeit kann daher nicht allein durch das Vorliegen einer Parkinson-Erkrankung angenommen werden, sondern dies muss im Einzelfall geprüft werden.
Das Gericht wertete im vorliegenden Fall ärztliche Stellungnahmen und ein Sachverständigengutachten aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass der Erblasser zur Testierfähigkeit in der Lage war. Die behandelnden Ärzte und Pflegekräfte konnten keine schwerwiegenden kognitiven Defizite feststellen, und der Erblasser war in der Lage, Willenserklärungen abzugeben.
Fazit
Das Urteil verdeutlicht, dass selbst bei schweren gesundheitlichen Einschränkungen, wie sie bei einer Parkinson-Erkrankung auftreten können, die Testierfähigkeit des Erblassers nicht automatisch in Frage gestellt werden darf. Die individuelle Beurteilung unter Berücksichtigung medizinischer Gutachten und ärztlicher Stellungnahmen als auch der rechtlichen Perspektive ist entscheidend. In der Praxis ist hierbei entscheidend, dass derjenige die Beweislast bzw. Feststellungslast trägt, der sich auf die Testierunfähigkeit beruft.
Das Urteil unterstreicht auch die Bedeutung eines klaren und eindeutigen Testaments, unabhängig vom gewählten Schriftträger.
Um sicherzustellen, dass Ihre letztwillige Verfügung den gesetzlichen Anforderungen entspricht, aber umso mehr, um nachträgliche Erbstreitigkeiten aufgrund von fehlenden oder unklaren letztwilligen Verfügungen oder steuerlich ungünstige und unnötig belastende Rechtsfolgen zu vermeiden, empfiehlt sich insoweit in der Regel, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Bei Fragen zur Testierfähigkeit oder Gestaltung Ihres Testaments stehen wir Ihnen mit unserer rechtlichen Expertise gern zur Seite.


